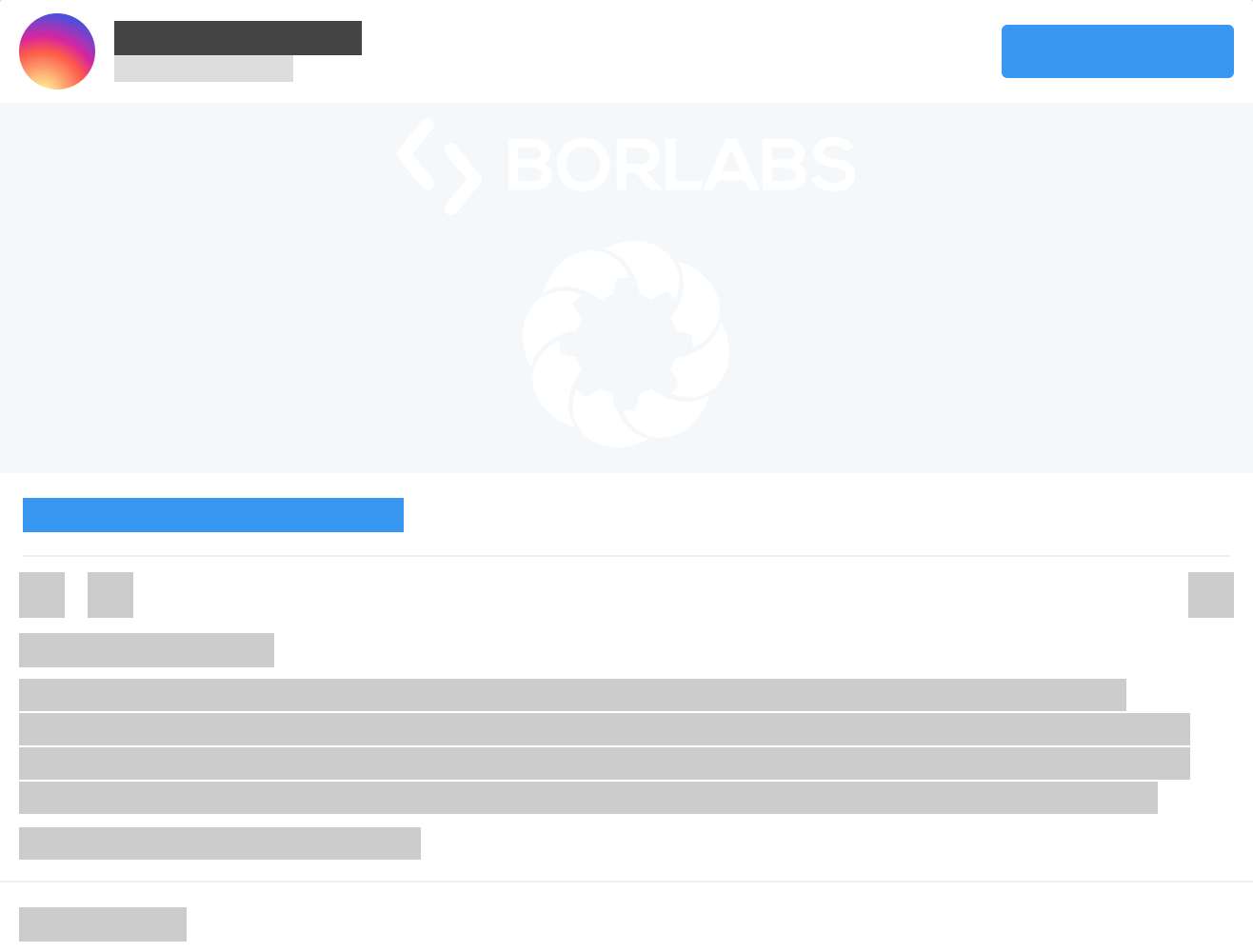Phobiarama: Eine Reise durch die eigenen Ängste
Im Rahmen der Wiener Festwochen schickt uns der Künstler Dries Verhoeven noch bis 22.Mai auf eine Schreckensfahrt ins Reich der eigenen Urängste. Herzlich willkommen in Phobiarama: Eine Reise, die einen nicht nur erschaudern lässt, sondern auch gesellschaftspolitische Fragen aufwirft. Ein Erfahrungsbericht.

Es war ein sonniger Samstag Nachmittag, den ich wartend mit meinem Freund im Meusuemquartier verbracht habe. Ich hatte keinen Schimmer, dass ich kurz davor war, die erschreckendste Autodromfahrt meines Lebens zu machen. Autodrom? Ja, richtig gelesen. Man denkt an Kirtag, an Spaß und lachende Kinder. Doch im Rahmen der Wiener Festwochen lehrt man den Besuchern in der Installation „Phobiarama“ in ebendiesen kleinen Autos das Fürchten. In der rund 50 minütigen Fahrt werden Urängste geweckt und einem die politische Instrumentalisierung der menschlichen Ängste vor Augen geführt.
Willkommen in der Finsternis.
„Bitte gehen Sie zu Zimmer Nummer sechs“, erklärt uns eine junge Dame, die uns den Haupteingang zu „Phobiarama“ öffnet. Ich taste mich in einem stockfinsteren Gang vor, bis ich eine leuchtende „6“ und eine Türklinke entdecke. Es wundert mich, wie finster die Finsternis hier drin ist. Mein Leben in der Stadt hat mich vergessen lassen, wie es ist, wenn keine Laterne, kein Auto und kein Screen für zumindest ein wenig Sicht und Orientierung sorgen. Ein erstes Unwohlsein macht sich breit.
Ich öffne die Tür Nummer sechs und zu meiner Überraschung erwartet mich ein leerer Raum, in dem sich nichts als ein Autodrom befindet. Wir setzen uns hinein und warten. Kleine Fernsehgeräte, die sporadisch in den Ecken montiert sind, spenden flackerndes, nervöses Licht. Mein Freund legt seine Hand auf mein Knie und wird sie für die nächsten 50 Minuten von dort auch nicht wegnehmen. Die Fahrt beginnt.
Die „berechtigten Ängste der Bürger“
Während wir uns mit vorerst moderater Geschwindigkeit durch die verwinkelten Räume bewegen, ertönen aus den Lautsprechern diffuse Geräusche und Stimmen heimischer Politiker sowie Menschen, die ich nicht zuordnen kann. Sie erzählen von Flüchtlingsströmen, vom Klimawandel, vom „sich fremd fühlen im eigenen Land“. Man kennt die Phrasen von den „berechtigten Ängsten der Bürger“ bereits zu gut, werden wir doch Tag für Tag im Zuge unseres Medienkonsums mit ihnen konfrontiert.
Wartet hinter der nächsten Ecke etwas auf mich, das mich erschrecken wird? Was passiert hier mit mir? Was soll das? In meinem Kopf braut sich ein Gedankengewitter zusammen in der Hoffnung, durch Rationalität ein wenig Entspannung zu finden. Denn ebenso wie man sich beim Betreten des Phobiarama Zeltes von Tageslicht verabschiedet, sagt man auch zur Rationalität adé. Willkommen im Reich der subversiven Furcht. Es ist der Beginn einer Fahrt, die mich auf eine Reise zur Konfrontation mit meinen eigenen Urängste mitnimmt.
Die Angst vor der Abstraktion
Meine Befürchtung bewahrheitet sich: Nach einiger Zeit füllt sich das Zelt, das wir durchkreisen, mit langsam wankenden Silhouetten, die ich vorerst nicht genauer erkennen kann. Sie bewegen sich langsam, aber bestimmt auf uns zu und ich erkenne, dass es knapp zwei Meter große Bären sind. Ich beginne wieder zu rationalisieren: Offenbar haben sich also Menschen Bärenkostüme übergezogen und wanken mir hier entgegen. Okay, was soll passieren. Sie deuten an meine – mir heilige – Individualdistanz, meine intime Zone, zu überschreiten. Meinen Puls bekomme ich durch die Versuche, die Situation zu rationalisieren, nicht unter Kontrolle. Er schnellt in die Höhe, ich fürchte mich. Ich neige bei starken Empfindungen grundsätzlich zu körperlichen Reaktionen. Ich spüre, wie sich die Angst mehr und mehr in meinen Beinen festsetzt und meine Knie auf eine ganz eigene Art beginnen zu schmerzen. Warum mache ich das hier nochmal?
Von der Angst, die Kontrolle zu verlieren
Die Fahrt wird zunehmender intensiver. Die Bären kommen näher, sie verfolgen einen, die Geschwindigkeit wird immer schneller und ich beginne mich zu fragen: Was, wenn ich hier raus will? Kann ich mitentscheiden, wann ich die Fahrt beenden will? Habe ich noch ein letztes Stück Kontrolle darüber zu entscheiden, wann es für mich genug ist und ich aussteigen möchte? Gleichzeitig aber macht sich ein konträres Gefühl breit: Neugierde.
Viel Zeit bleibt mir allerdings nun nicht, mich diesen Gedanken zu widmen, denn das Auto bleibt stehen. Neben uns einer der Bären, der sich langsam vor uns stellt, uns anstarrt, uns durch seine bloße Anwesenheit und seinen Stillstand in einen widersprüchlichen Zustand aus Angst und Neugierde versetzt. Er befreit sich von seinen Bärentatzen, befreit sich von seinem Bärenkopf, befreit sich von seinem restlichen Bärenkostüm. Darunter verbirgt sich – ich dachte es mir schon – die mir schon immer absurdest scheinende Form der Kostümierung: Ein Clown. Rotes, lockiges Haar, ein übertrieben geschminkter, grinsender Mund, eine rote Nase. Ich frage mich, wie man Clowns auch außerhalb dieses Gruselkabinetts amüsant finden kann. Sie schüren tiefste Furcht und mir wird einmal mehr bewusst, was Stephen King zu „Es“ inspiriert hat. Es scheint naheliegend, dass diese Wesen einem nichts Gutes wollen.
Wir fahren weiter. Diesmal rückwärts – ein intensiver dramaturgischer Effekt – denn die Angst sitzt mir jetzt wortwörtlich im Nacken. Kopfwendend versuche ich mich darauf vorzubereiten, wo der nächste Clown lauert und mich erschrecken wird. Doch es sind zu viele, die Fahrt ist zu schnell, das Licht zu dunkel und der Stress zu groß: Ich versuche meine Augen zu schließen und mich aus dieser Situation hinauszudenken. Ein gescheiterter Versuch – denn nur, weil man wegsieht und sich verschließt, bleibt die Bedrohung, so wie ich sie wahrnehme, präsent. Ich drehe meinen Kopf nach links, sehe meinem Freund in die Augen. Ich drehe meinen Kopf nach rechts, und beginne zu schreien: Ein Clown starrt mir nur wenige Zentimeter von mir entfernt ebenfalls in die Augen. Adé Tageslicht, adé Kontrolle, adé Individualdistanz.
Die flackernden Bildschirme in den Ecken spenden nicht nur ein wenig Licht, sie dienen nach einiger Zeit auch als Überwachungsmonitore. Ich sehe mich und meinen Freund darin, starre in den Bildschirm und starre mir selbst entgegen. Ich erkenne die Fahrgäste hinter uns, erkenne die verwinkelte Strecke.
Die Transformation vom Bären zum Clown sollte nicht die einzige bleiben. Wir bleiben wieder stehen, und die Clowns beginnen sich zu entblößen. Sie ziehen ihre hellblauen Anzüge aus, legen ihre Masken und Perücken ab. Was sich darunter verbirgt? Stereotype der Angst, wie sie uns ununterbrochen in Medien vermittelt werden: Große, starke, Männer. Teilweise tätowiert, auftrainiert, mächtig und nackt bis auf die Unterwäsche. Sie stellen sich vor uns hin, starr, und suchen unseren Blickkontakt. Ein einziger Gedanke breitet sich wie eine Nebelwolke in meinen Gedanken aus: Bitte komm mir nicht zu nahe, bitte berühr mich nicht, bitte bleib fern. Doch warum? Ich weiß, ich befinde mich in einer Kunstinstallation, es kann nichts passieren, es sind Schauspieler, in wenigen Momenten werde ich im Tageslicht durch das Museumsquartier spazieren und all das mit meinem Freund gemeinsam reflektieren. Wir werden uns zusichern, dass es absurd war, sich so zu fürchten, wir wussten ja, dass es eine Kunstaktion ist. Aber hatten diese Gedanken in der Konfrontation mit dem Mann, der mich hier, im dunklen, engen Raum anstarrte, eine beruhigende Wirkung? Nein. So irrational meine Angst auch ist, sie ist eben da. Ich spüre sie, sie kehrt immer tiefer in meine schmerzenden Knie, meinen Bauch und meinen Kopf.
Nach 50 Minuten endet diese Reise. Diese Fahrt durch das schwarze Zelt, das neben dem Museumsquartier aufgeschlagen wurde, hat mich ein Stück weit Näher und Bewusster an meine irrationalen Ängste gebracht. Die wohl intensivste Erfahrung, die ich im Rahmen eines Kunstprojektes je erlebt habe.
Die Frage, die sich bis heute stellt: Was macht mir in Endeffekt mehr Angst? Menschen in gruselerregenden Bärenkostümen und Clowns, die mich in dunklen Räumen verfolgen? Oder die Tatsache, dass Politiker ebendiese oft irrationalen Ängste zu instrumentalisieren wissen und sie für Machgewinn und Machterhalt nutzen?
Tage danach ist mir die Zeile des derzeitigen Bundeskanzlers der „berechtigten Ängste der Bürger“ lebhaft im Gedächtnis und die Frage bleibt: Wie viel Kalkül steckt in solchen Reden? Wie viel meiner Ängste werden künstlich geschürt, um daraus politischen Profit zu schlagen?