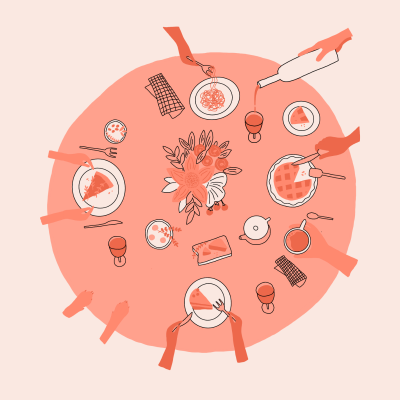Unser Senf: Warum Skifahren das Beste auf der Welt ist

* In den folgenden Absätzen wird Skifahren als Überbegriff für Brettl-Wintersport verwendet. Sorry, Snowboarder!
Wolfgang Ambros hatte sowas von recht. Nichts geht über das Gefühl, sich in die Kurve zu legen und Schnee und Kanten den Rest machen zu lassen. Ich strecke die Arme seitlich aus und lasse mir den Fahrtwind um die Ohren pfeifen. Das ist fliegen. Ich ziehe ein, zwei, drei weite Bögen über ein Flachstück und komme mir dabei vor, wie einer dieser Motorrad-Rennfahrer, die sich so stark in die Kurven legen, dass sie sich die Hosenbeine am Asphalt wegbrennen. Ich lasse mich direkt in den nächsten Hang fallen, scanne die Piste vor mir, registriere eisige Flächen, buckelige Stücke und die weichen, von lockerem Schnee bedeckten Pistenränder. Vor mir Brettlsport-Kollegen, die sich ebenfalls die Kante geben – im Schneesport-Sinn, versteht sich. (Alkohol auf der Piste ist meines Erachtens nach ein absolutes No-Go.) In der Ferne wuseln sie wie Ameisen über den Hang. Innerhalb von Millisekunden entscheide ich, wohin mich die nächsten paar Schwünge führen. Und wenn’s einmal unheimlich wird, singe ich ein bisschen vor mich hin. Das ist mein coping mechanism auf Eispisten, denen ich mich nicht gewachsen fühle, seit ich als fünf Jahre alter Ski-Frischling erstmals mit weichen Knien die abgefahrene Loser-Abfahrt (Loser wie der Hausberg von Altaussee, nicht wie Verlierer) hinuntergerutscht bin.
So schön, dass es kitschig ist
Immer wieder bleibe ich stehen. Manchmal weil meine Oberschenkel brennen, manchmal um auf meinen Pisten-Squad zu warten, und manchmal möchte ich kurz den Moment wahrnehmen. Das Schönwetter-Szenario: Ich blicke in die Ferne, genieße das Panorama mit den verschneiten Gipfeln, die sich in der Ferne hintereinander reihen, und realisiere, wie hoch über allem ich gerade bin. Und ja, das mag jetzt kitschig klingen, aber: Wie genial ist es eigentlich, dass ich das erleben kann? Hoch auf dem Berg, wo ich sonst im Sommer nur nach stundenlanger Wanderung hinkomme, um mich herum Bäume, Schnee, Sonne und so viel Himmel. Die Sonne zeichnet weiche Schatten auf den Schnee und lässt die Hänge aussehen wie auf Tourismus-Werbeplakaten der 50er-Jahre. Auf der Piste formen die Stöpsel der Ski-Schul-Gruppen vorsichtig Pizza-Schnitten und meistern Kurve für Kurve.
Einfach schwingen
Bei Schnee und Wind sieht die Sache anders aus. Da erwacht die Abenteurerin in mir. Solange ich Piste und Himmel unterscheiden kann und nicht eine einzige weiße Nebelwand vor mir habe, sind verschärfte Verhältnisse eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Mein wichtigstes Mantra beim Skifahren ist: Ich bestimme, wo es lang geht, nicht der Schnee. Nicht dass ich davon ausgehe, dass sich Schneewehen dann denken: „In Ordnung, also verzupfe ich mich einmal um ein paar Meter, damit die Pia hier in Ruhe ihre Schwünge machen kann.“ Ich versuche einfach, meinem Kopf und meinem Körper zuzutrauen, dass wir mit dem Schnee klarkommen. Doris „Einfach schwimmen!“ wird auf der Piste zu „Einfach schwingen!“. Zum Beispiel auf Buckelpisten. Sie sind die totale Probe für Koordination und Ausdauer: zack, zack, zack, Knie umlegen und in der Beugung flexibel halten, die Oberschenkel brennen, durchhalten und dann außer Atem und voller Stolz am Fuß des Hanges zum Stehen kommen.
Im Tiefschnee muss der Schwerpunkt nach hinten und dann hüpft man wie ein Floh über die glitzernde Zuckerfläche. Sauanstrengend, aber saulustig. Ein weiteres Motto ist: Ganz oder gar nicht. Verunsichert die Piste hinunterzurutschen ist demotivierend, funktioniert schlecht und schabt den Schnee vom Hang. Die beste Methode, eine einschüchternde Piste zu bezwingen, ist, sich ordentlich auf die Ski und damit auf die Kanten zu stellen, den eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und die Challenge anzunehmen. Mit Helm und Skibrille kann in der Regel wenig passieren. Ohne Helm fahre ich überhaupt nicht gut. Ich bin nicht entspannt und fühle mich unsicher, weil ich weiß, dass ich mich gefährde. Auch wenn ein Helm nicht vor Verletzungen jeder Art schützt, weiß ich, dass einer der empfindlichsten Teile meines Körpers so gut wie möglich gesichert ist. Mit Helm ist die Vorstellung zu stürzen gleich viel weniger beängstigend.
Die schönen Extras
Um dem Suppen-Koma keine Chance zu geben, gehe ich zu Mittag lieber nicht auf die Hütte. Stattdessen gibt’s zur Stärkung zwischendurch Weckerl, Käse und ein bisschen Schoki. Schoki hatte schon der Papa immer dabei. Auch heute noch. Eine Zeit lang gab es beim Hofer einen Twix-Knock-Off namens Speed. Den hatte er immer im Rucksack. Noch heute frage ich mich, was sich die Leute im Lift oder in der Gondel gedacht haben müssen, als wir Kinder unseren Vater nach Speed fragten. Für die Jause stapfe ich vom Trubel weg und setze mich auf ein Platzl im Schnee in der Sonne, von dem aus ich auf die umliegenden Berge blicken kann. Deftig wird’s erst zum Abschluss auf der Hütte.
Nach einem langen Skitag schmecken heiße Schokolade mit Schlagobers oder ein saftiger Germknödel mit geschmolzener, brauner Butter und ganz viel Mohn am allerbesten. Beim Auto wechsle ich die Skischuhe gegen feste Winterschuhe, in denen ich mir in dem Moment dann leicht wie eine Feder vorkomme. Zuhause freue ich mich auf eine erfrischende Dusche und bald kommt auch wieder der Hunger – kein Wunder, nach so viel Bewegung. Nach Skitagen bin ich meist auch sehr bald reif fürs Bett. Selten schlafe ich so tief und gut, wie nach einem Tag auf dem Berg.
Teuer, aber wertvoll
Ja, es stimmt: Leider ist Skifahren in den vergangenen Jahrzehnten empfindlich teurer geworden. Besonders mit Studentenbudget und größeren Familien tut das weh. Schade, dass die Überwachungssysteme heutzutage so gut sind, dass es keine Option ist, sich mit einer Kinderkarte durch den Skitag zu schummeln. Sich wie mein Großvater damals vor 50 Jahren mit den Händen von unten an einen Liftsessel zu hängen, sollte man besser auch nicht versuchen. Erstens weil eh scho‘ wissen, und zweitens würde sich der Liftwart womöglich den Spaß nicht nehmen lassen, den Betrieb für ein paar Minuten abzustellen und das ungewollte Anhängsel schön im kalten Wind baumeln zu lassen. Nicht nur die Liftkarte, auch die Ausrüstung reißt ein Loch ins Konto: Skijacke, Skihose, Skiunterwäsche, Skischuhe, Skistöcke und die Brettln selbst, Helm, Handschuhe, eventuell noch eine Sturmhaube, schon ist man um ein paar Hunderter leichter.
Aber: Im Abverkauf gibt es alles wesentlich billiger. Ski der vorhergegangenen Saison sind 100 bis 300 Euro günstiger, als die der aktuellen. Über Flohmarkt-Apps und Online-Marktplätze findet man gebrauchtes Equipment. Die gute Nachricht ist: Das Equipment hält sich in der Regel über Jahre. Wer sich die Schlepperei sparen möchte oder nicht so oft auf die Piste geht, leiht sich die Ausrüstung eben für ein paar Tage vor Ort aus. Ob ordentliche Wanderschuhe oder Ski: Ausrüstung, die es mir ermöglicht, die verschiedenen Facetten der reichen Natur zu erleben, mit der wir in Österreich wirklich gesegnet sind, ist für mich eine lohnende Investition. Ein Tag auf Brettern beinhaltet alles, was Ärzte und Psychologen empfehlen: Frischluft, Bewegung in der Natur, Spaß und Genuss. Und wenn euch das nicht überzeugt, dann wird es Wolfgang Ambros tun:
Unser Redakteur Jan Pöltner sieht das ganze Thema vollkommen anders. Er schläft lieber aus, als sich den Ski-Zirkus anzutun.